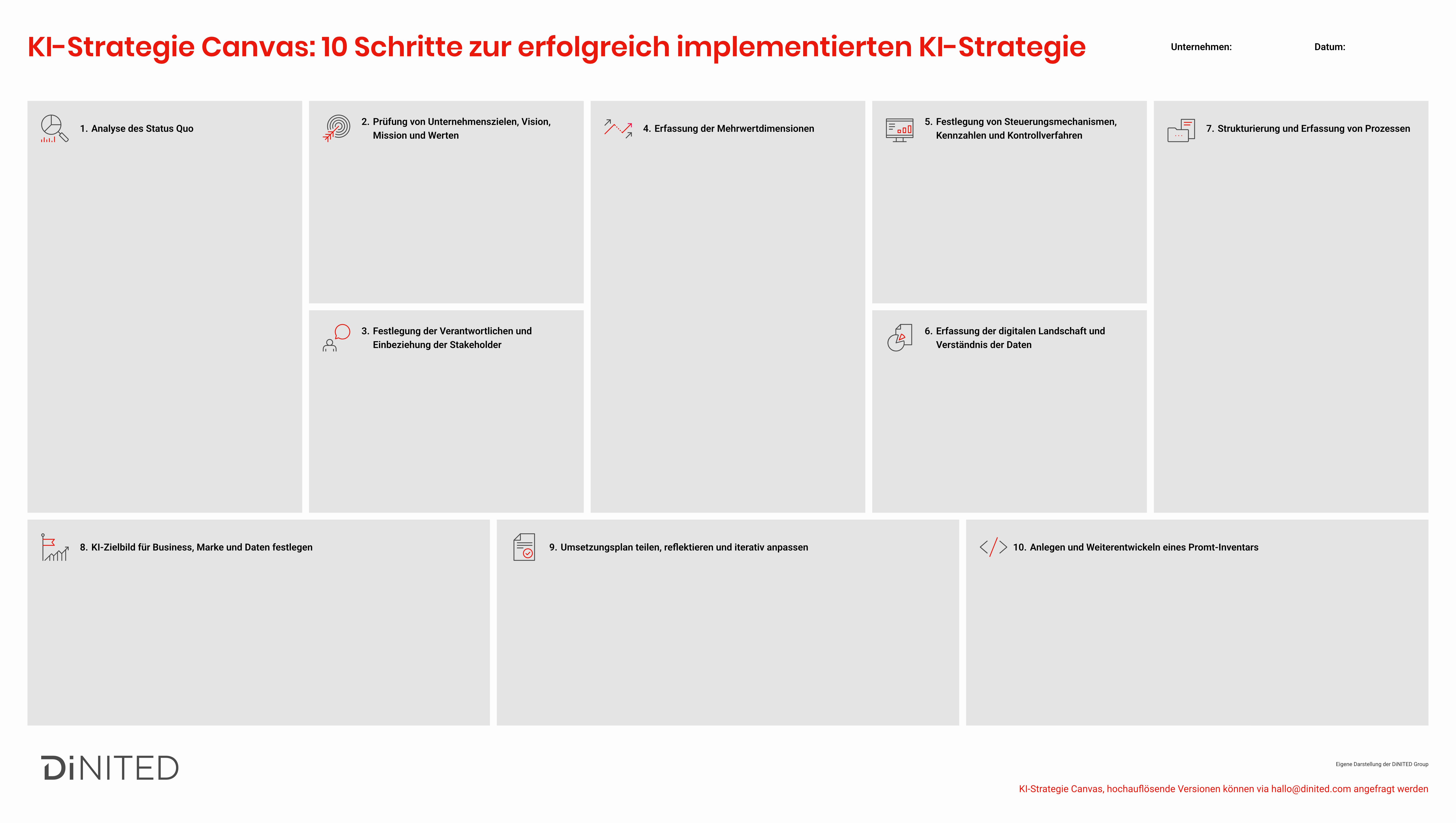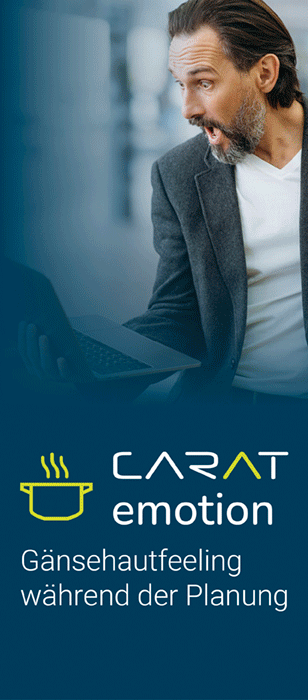Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. Obwohl ChatGPT erst im November 2022 offiziell veröffentlicht wurde, sind KI-Tools – insbesondere generative KI-Tools – bereits fest in unseren Alltag integriert. Sie tragen dazu bei, unsere alltäglichen Prozesse effizienter zu gestalten. Doch warum ist das so? Und wie kann insbesondere der Mittelstand KI erfolgreich implementieren und nachhaltigen Nutzen daraus ziehen? So gelingt der Weg in die Zukunft mit angewandter generativer Künstlicher Intelligenz im Mittelstand, sagt unser Autor.
Der technische Fortschritt, technologische Veränderungen, volatile Märkte und immer kürzere Innovationszyklen prägen unseren Alltag. Berücksichtigt man, dass bereits von der fünften industriellen Revolution, der Industrie 5.0, gesprochen wird – geprägt von kognitiven maschinellen Fähigkeiten –, ist es bemerkenswert, dass seit der sogenannten Industrie 4.0, charakterisiert durch das Internet der Dinge und vernetzte Systeme, gerade einmal zehn Jahre vergangen sind. Die vorherige Phase, Industrie 3.0, lag circa 40 Jahre vor der Industrie 4.0. Sie war gekennzeichnet durch Computer, Elektronik und Automation.
Davor dauerte es fast 100 Jahre vom Wandel der Industrie 2.0 – der Massenproduktion und Elektrifizierung – bis zur Industrie 3.0. Es wird deutlich, dass sich die Innovationszyklen immer weiter verkürzen und dass disruptive technologische Veränderungen in einer Exponentialfunktion verlaufen und deshalb schneller erkannt und integriert werden müssen. So werden Wettbewerbsvorteile gesichert, um nicht von Mitbewerbern oder neuen Marktteilnehmern überholt zu werden.
Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, Wissensmonopole, Neubesetzung von Schlüsselpositionen
Neben der Herausforderung des ständigen Wandels kommt die aktuelle Situation in Deutschland hinzu, die von drei großen unternehmerischen Risiken geprägt ist. Erstens wird prognostiziert, dass der Arbeitsmarkt bis 2060 etwa fünf Millionen Arbeitskräfte aufgrund demografischer Entwicklungen weniger haben wird. Zweitens sind laut Informationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aktuell mehr als 350 von 801 Berufsgattungen mit Fachkräftemangel konfrontiert. Drittens besteht das Problem der sogenannten Wissensmonopole in Organisationen – das Risiko des nicht dokumentierten Wissens und der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen in Organisationen. Diese Personen, wie die unersetzliche Frau Müller oder der essenzielle Herr Maier, halten den Betrieb am Laufen. Dies stellt nicht nur ein Risiko dar, wenn solche Schlüsselpersonen in Rente gehen, sondern ist auch oft eine Herausforderung bei der Nachbesetzung dieser Positionen. Denn die Frage bleibt: Wie können Nachfolger ihren Alltag genauso gewinnbringend für die Organisation gestalten, besonders wenn ihre Vorstellungen von Arbeit möglicherweise von denen anderer Generationen abweichen?
Der Ruf nach Automatisierung, maschineller Intelligenz und intelligenteren Prozessen wird immer lauter. KI, insbesondere angewandte KI, bietet uns die Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, den Alltag effizienter zu gestalten und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Doch wie beginnt man, und worauf sollte der Fokus liegen? Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir ein KI-Implementierungsframework entwickelt. Dieses hilft, in wenigen Schritten ein klares Bild von den Chancen und Herausforderungen bei der Implementierung von KI zu gewinnen, und bietet eine umfassende Perspektive auf die Organisation. Über zehn Schritte sorgt das Framework für mehr Klarheit im Implementierungsprozess.
Es ist essenziell zu verstehen, dass KI grundlegende Probleme wie mangelnde Struktur oder fehlende Prozesse nicht ersetzen kann. KI unterstützt durch kognitive Fähigkeiten und steigert Effizienz und Effektivität – vor allem von Experten innerhalb der Organisation. Neben der Implementierung von KI-Tools sollte der Fokus daher auch auf Prozessautomatisierung und Workflow-Management liegen. Das bedeutet, dass jede Organisation diverse Schnittstellen, Tools, Datenbanken und Dienste besitzt, die oft isoliert von einzelnen Experten genutzt werden. Eine konsequente Öffnung der Systeme durch Schnittstellen ermöglicht es, dass diese miteinander kommunizieren können. Wenn Systeme miteinander kommunizieren, kann KI menschliche Leistung und Wertschöpfung bei dieser Kommunikation übernehmen. Oft wird sichtbar, dass KI in Implementierungsprozessen nur 10 bis 20 Prozent der Prozessbearbeitung ausmacht. Aber gerade diese 10 bis 20 Prozent haben uns bis vor einigen Jahren daran gehindert, unsere Prozesse konsequent zu digitalisieren und zu automatisieren. Die Rolle der Mitarbeitenden wird sich signifikant ändern. Anstatt Prozesse aktiv zu bearbeiten, werden smarte Assistenten die Arbeit vorbereiten, die dann lediglich kontrolliert und bewertet wird.
Künstliche Intelligenz befasst sich mit Methoden, die Computern das Lösen von Aufgaben ermöglichen, die Intelligenz erfordern, wenn sie von Menschen gelöst werden. Moderne KI-Modelle können Sprache, Ton, Text, Bewegungen, Wahrnehmungen und Logik thematisch entschlüsseln und einordnen. Ein solcher technologischer Fortschritt ist auch die Basis für Entwicklungen wie ChatGPT (die führende generative KI von OpenAI, die über den Browser, Schnittstellen oder eigene Architekturen genutzt werden kann). Die Methode der Transformer, eine Deep-Learning-Architektur, wurde 2017 von Google im Rahmen der Neural Information Processing Systems-Konferenz vorgestellt. Sie ermöglicht es, umfassende Texte zu generieren und passende Antworten oder Ergebnisse auf Eingaben zu liefern.
Die Investitionen in KI-Forschung und -Entwicklung nehmen zu. Deutsche Firmen wie Aleph Alpha mit ihrem Chatbot Luminous, Google mit dem Gemini Service (früher bekannt als Bard), Microsoft mit dem Copiloten, Anthropic mit Claude, Meta mit Llama 2 oder Ernie von Baidu als eine der vielen Lösungen aus China, treiben diese Entwicklungen voran. Viele smarte KI-Tools sind heute bereits vortrainiert und unterstützen bei der Lösung alltäglicher Probleme. Daher lautet die Empfehlung, zunächst mit vortrainierten Modellen zu beginnen und bei signifikanten Effizienzsteigerungen durch erfolgreiche Implementierung die Einsparungen in die Entwicklung eigener KI-Modelle zu investieren. Die erwähnten Modelle und Services, auch bekannt als generative vortrainierte Transformer, basieren oft auf Hunderten von Petabyte an Trainingsdaten und können mit eigenen Daten kombiniert werden, um im Rahmen der trainierten Fähigkeiten passende Ergebnisse zu generieren.
Mit überschaubaren Investitionen können schnell Ergebnisse erzielt werden. Stellen Sie sich vortrainierte Modelle wie einen wartenden Assistenten vor, der Ihr Briefing und Ihre Aufgaben voller Tatendrang entgegennimmt, um definierte Lösungen zu liefern. Dies führt uns ohne Umwege zu einem der größten Hebel im Kontext der Implementierung von generativer KI in Organisationen und Institutionen: das Formulieren der Problemstellung, die durch KI gelöst werden soll. Dies geschieht in sogenannten Prompts, also Anweisungen an die Maschine. Organisationen, die ihre Prozesse klar dokumentiert und Arbeitsanweisungen strukturiert formulieren können, werden hier Vorteile haben. Das sogenannte Prompt Engineering – die Entwicklung von Anweisungen, die Wertschöpfung in bestehende Prozesse integrieren – wird eine der wichtigsten organisatorischen Verwaltungs- und Wertschöpfungsdisziplinen in der Zukunft sein. In den USA wird diese Qualifikation heute bereits mit teils mehr als 300.000 US-Dollar Jahresgehalt (vgl. Forbes) honoriert. Ein gutes Prompt Engineering ermöglicht es, die Wertschöpfung einer Organisation einer Maschine zu erklären und die Aufgaben auf diese zu übertragen, um damit mehr Effizienz, Konsistenz und eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erzielen. Das Management und die Pflege Ihres Prompt-Inventars werden essenziell sein, und bestehende Prozessdokumentationen sollten um Prompt-Definitionen erweitert werden.
Das Feld der angewandten KI ist gerade für Mittelstandsunternehmen so attraktiv, weil es mit kalkulierbaren Anfangsinvestitionen verbunden ist. Heute modellieren wir unsere Prozesse Schritt für Schritt und übertragen bzw. manipulieren Daten zwischen Systemen. Dabei verfolgen wir einen sogenannten API-First-Ansatz oder setzen auf sogenannte Composable Application Architekturen, ein Modell, in dem Systeme offen miteinander kommunizieren und durch weitere Tools oder Anwendungen unterstützt oder ergänzt werden. Dies kann beispielsweise die bildgebende KI von Microsoft Azure, der ChatGPT von OpenAI oder die Bildgenerierung von Midjourney sein. Diese Tools werden über Schnittstellen angesteuert und generieren basierend auf den übermittelten Prompts ihre Ergebnisse. Sollte morgen ein besseres Tool auf dem Markt verfügbar sein, kann es einfach in die definierten Arbeitsprozesse integriert und bestehende Tools ersetzt werden. Diese Arten von Architekturen beugen Monolithen vor und sorgen für flexible Systeme und schnellere Anpassungsmöglichkeiten.
Das alles ist aber nur sinnvoll, wenn wir ein klares Bild von unserer organisatorischen Zukunft haben. Ohne eine KI-Strategie lassen wir Wettbewerbsvorteile und Effizienzgewinne ungenutzt. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Nachfrage innerhalb der Google-Suche nach bestimmten Begriffen in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz betrachtet, etwa die Nachfrage nach ›ChatGPT‹ verglichen mit der suchinduzierten Nachfrage nach ›Google Bard‹ oder ›Google Gemini‹. Das normalisierte Nachfrageniveau zeigt einen Unterschied von mehr als 76 Prozentpunkten weltweit oder sogar 87 Prozentpunkten in Deutschland (Quelle: Google Trends, Abruf vom 11.03.2024, Vergleich ChatGPT (Software), Google Gemini (Thema), Google Bard (Suchbegriff), Künstliche Intelligenz (Thema)). Hier wird der First-Mover-Effekt, an den wir uns aus den Marketingbüchern erinnern, deutlich sichtbar und man versteht, dass dies doch mehr als ein rein theoretisches Marketingkonzept ist.
Bei der Entwicklung einer erfolgreichen KI-Strategie können die folgenden Schritte hilfreich sein, angelehnt an die Methodik des Design Thinking, wie es aus der Lean-Startup-Lehre bekannt ist. Zunächst gilt es, die aktuelle Position zu verstehen und die Geschehnisse im Umfeld zu erfassen. Anschließend beobachtet man das eigene Handeln und definiert darauf aufbauend ein klares Zielbild. Danach wird in kleinen, iterativen Schritten mit ersten Umsetzungen und Verbesserungen begonnen, die direkt getestet werden. Nur nach erfolgreicher Implementierung oder der bewussten Entscheidung, eine Teilaufgabe zu verwerfen, sollten neue Aufgaben in Angriff genommen werden. Die folgenden Schritte dienen als Leitfaden, um eine KI-Strategie erfolgreich zu implementieren: