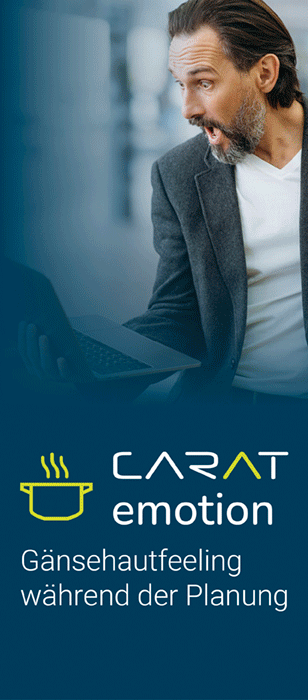Spezial Neue Ideen:
Hettich
„Wir haben eine Many-to-many-Management-Kultur“
Durch die Transformation führen mit geänderter Führungskultur: So kann man Aufgabe und deren Lösungsansatz beim Beschlaghersteller Hettich beschreiben. Wie steuert man aus dem eher beschaulichen Kirchlengern einen weltweit tätigen Hersteller, der auch in China, Indien oder den USA seine Erfolge ausbauen will? Wie kommt ein Unternehmen durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre, von Pandemien über weltwirtschaftliche Verwerfungen bis hin zu Konflikten um Rohstoffe? – Wir haben Vertreter des Hettich-Führungsteams in einer morgendlichen Runde vor Ort im Hettich-Forum dazu befragt. Wie sich schnell herausstellte, hätten wir die ganzen Definitionen und Diagramme zu Organisationsstrukturen ruhig zu Hause liegen lassen können. Warum, lesen Sie hier.
-857dc8b9.jpeg)
Sascha Groß: Jahrgang 1974, bei Hettich seit 2004. Aktuelle Aufgabe: seit 2017 Geschäftsführer der Hettich-Gruppe. Werdegang im Unternehmen: Projektmanager, Geschäftsführer Hettich China, Geschäftsführer Hettich Tschechien, Regional Director
-05a30abc.jpeg)
Matthias Oetting: Jahrgang 1977, bei Hettich seit 2023. Aktuelle Aufgabe: seit 2023 Director Marketing bei Hettich in Kirchlengern. Werdegang im Unternehmen: als Director Marketing eingestiegen
-8603bdb1.jpeg)
Jana Schönfeld: Jahrgang 1978, bei Hettich seit 2017. Aktuelle Aufgabe: Geschäftsführerin der Hettich-Gruppe. Werdegang im Unternehmen: als Geschäftsführerin eingestiegen
-1968734c.jpeg)
Philipp Rode: Jahrgang 1979, bei Hettich seit 2016. Aktuelle Aufgabe: Seit 2018 Geschäftsführer in der Hettich-Gruppe am Standort Kirchlengern.
-78c7765b.jpeg)
Michael Lehmkuhl: Jahrgang 1976, bei Hettich seit 2002. Aktuelle Aufgabe: seit 2016 Geschäftsführer in der Hettich-Gruppe am Standort Kirchlengern, Hauptsitz für Entwicklung und Produktion von Auszugsführungen und Schubkastensystemen. Schwerpunkte u.a. im Innovationsmanagement, Produktmanagement, F&E, Projekte und Qualitätsmanagement. Seit 2024 weitere Tätigkeitsschwerpunkte im Marketing und Vertrieb in der Gruppe. Werdegang im Unternehmen: Qualitätsingenieur, Verantwortlicher Qualitätsleiter, entwicklungsverantwortlich, Leiter Qualitätsmanagement, Projektleiter
INSIDE: Guten Tag zusammen. Das ist ja eine größere Runde heute Früh. Passenderweise haben wir einen Stuhlkreis gebildet, da kommen wir ja sicher sehr gut ins Gespräch. Wir wollen dem auf die Spur kommen, was man im Allgemeinen als Firmenkultur beschreibt, und dem Erfolgsgeheimnis der Unternehmensgruppe. Was macht das Arbeiten bei Hettich aus, was macht es in Ihren Augen besonders?
Jana Schönfeld: Das wichtigste Grundprinzip ist, dass sich jeder bei uns mit seinen Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich einbringt. Deswegen sitzen wir heute zu fünft hier und nicht als Doppel-Geschäftsführung. Wir fünf sind Vertreter eines großen globalen Managementteams. An einem anderen Tag hätten Sie möglicherweise fünf andere Menschen getroffen. Da wir heute Verantwortung für die Gestaltung der Bilanz-Pressekonferenz übernehmen, die nach unserem Interview stattfinden wird, sind wir nun in dieser Besetzung hier und bringen verschiedene Kompetenzen und Perspektiven ein. Philipp Rode, Markt und Kunde sowie Märkte dieser Welt; Matthias Oetting, der bei uns für Marketing verantwortlich ist; Michael Lehmkuhl, mit dem Schwerpunkt Innovation, Produktmanagement und Produktion, und Sascha Groß, der mit mir das Geschäft global steuert, aber auch eine große Expertise in Produktion, Logistik und Internationalisierung hat; bei mir sind es mehr die Themen Strategie, Kaufmännisches, Unternehmenskultur und HR. Natürlich ist auch jede Persönlichkeit anders. Genau das schätzen wir und diese Unterschiedlichkeit möchten wir in unseren Alltag bei Hettich integrieren und zulassen.
Wie steuert man einen der wichtigsten Beschlaghersteller der Welt? Für Hettich arbeiten ja – verteilt auf 24 Länder – 8.600 Menschen. Welche Struktur ist da wichtig und wie wird diese Struktur aktuell mit Leben gefüllt?
Jana Schönfeld: Jeder Kollege, jede Kollegin bei uns hat unterschiedliche Leidenschaften: um Kunden zu begeistern, für tolle technische Lösungen, für Arbeits- und Gesundheitsschutz, für Nachhaltigkeit, für digitale Tools oder Kommunikation auf neuen Wegen, jemand anderes mehr für persönliche Begegnungen. Das steht nicht immer auf der Visitenkarte, doch wir bieten unseren Kollegen Möglichkeiten an, diese Interessen einzubringen. Unsere Idee dahinter: So muss sich niemand verstellen, arbeiten macht mehr Spaß und wir können alle gemeinsam erfolgreicher sein. Das ist ein wichtiger Baustein für uns.
Das klingt ja fast wie eine Fußballmannschaft, vielleicht eine ganz ohne Trainer-Team. Organisiert sich die Mannschaft selber?
Jana Schönfeld (lacht): Da muss ich doch gleich an einen meiner Kollegen übergeben, die mehr Fußball-Expertise haben . . .
Michael Lehmkuhl: Mannschaft ist ein gutes Beispiel. Mannschaft ohne Trainer, das ist eine Diskussion, die wir intern sehr intensiv führen. Wir haben verschiedenste Formen, wie wir unsere Teams führen, also nicht die eine Management-Methode oder Organisationsform. Bleiben wir im Bild: Wir haben Mannschaften, die organisieren sich selbst. Die haben ihren Spieler-Trainer in der Gruppe. Das sind Beispiele, da haben die Mitarbeiter teilweise zu uns gesagt: „Wir brauchen keine Führungskraft.” Also haben wir das zugelassen.
Was sind denn das für Gruppen bei Hettich, die so frei arbeiten? Können Sie da mal ein oder zwei Beispiele nennen?
Michael Lehmkuhl: Vor ein paar Jahren, so etwa 2016 oder 2017, haben wir erstmals mit selbstorganisierten Teams experimentiert. In dem Fall war das der Bereich Steuern. Es stand ein Führungswechsel an und das war der Anlass, es zu probieren. Wir haben geschaut, was macht denn an dieser Position die Führungskraft bisher aus? Menschen entwickeln, ihnen Möglichkeiten eröffnen. Wie konnten wir das weiter gewährleisten ohne die Führungskraft? Wir geben den Kollegen als Experten Freiraum sich einzubringen, sie geben sich gegenseitig fachliches Sparring. Wo erforderlich, assistieren wir als Coaches. Ein anderes Beispiel: Das Experten-Team, das die Managementprozesse rund um Corporate Responsibility aufstellt, haben wir später ebenfalls als selbstorganisiertes Team aufgestellt, nach dem Modell Spieler-Trainer, wenn man im Bild bleiben will.
Aber nicht alle arbeiten bei Hettich so, oder?
Michael Lehmkuhl: Wir haben auch Lösungen gefunden, da haben wir ein Trainer-Team, in einem Beispiel ein Trainer-Trio. R&D, Produkt- und Innovationsmanagement: Das waren früher getrennte Abteilungen bei uns, jetzt sind sie eine große Mannschaft. Damit nicht unterm Strich gegeneinander gearbeitet wird, sondern gemeinsam für den Kunden, haben wir nun ein Team von 150 Mitarbeitern mit drei Trainern. Alle Teile der Mannschaft spielen gemeinsam, vom Torwart bis zum Stürmer. Da ist immer einer ansprechbar, alle sind verantwortlich für den ganzen Prozess. Und das funktioniert ebenfalls sehr gut.
Diese drei Abteilungen haben Sie dann also ganz aufgelöst?
Michael Lehmkuhl: Von Abteilungen sprechen wir schon lange nicht mehr. Wir haben Funktionen. Und wir haben Menschen, die spezielle Expertisen für bestimmte Funktionen haben. Natürlich werden sie immer noch irgendwo organisatorisch zugeordnet. Wir leben es nicht als Bereich, sondern als Gesamtheit. Plakativ gesprochen: gemeinsames Arbeiten auf einer gemeinsamen Fläche und keine Feier nur der Entwickler, des Vertriebs oder der IT. Das zieht sich so durchs ganze Unternehmen. Und da ist das Zusammenarbeiten einfach schon durch solche Maßnahmen deutlich besser für alle Beteiligten.
Philipp Rode: Wir haben in der Vergangenheit auch Firmen zugekauft. Wenn man von der Gesamtmannschaft redet und von Abwehr, Mittelfeld und Sturm: Das waren teilweise unterschiedliche Einheiten, also Gesellschaften. Wir hatten ein durchaus ausgeprägtes internes Gesellschaftsdenken. Wir hatten einen Forschungs- und Entwicklungs-Bereich hier, einen da, den nächsten dort. Das ist das, was Michael gerade meinte: Da war wenig Interaktion oder nicht genügend. Und das haben wir in den letzten fünf Jahren gut hingekriegt. Weg von Mannschaftsteilen, hin zu einer Gesamtmannschaft. Ich kann mich noch gut an ein Meeting erinnern, da saßen Außendienst und Vertrieb erstmals mit den Entwicklern zusammen und haben über die Validierung eines neuen Produkts geredet. Dabei sind – auf beiden Seiten – Augen aufgegangen. Da kam es ständig zu „Ach so, deshalb”-Momenten. Das ist ein riesiger Vorteil, dass wir als ein Team denken und nicht in Abteilungen oder sogar in Einzelgesellschaften. Es ist nicht mehr so, wie es – überspitzt gesagt – zuvor war: „Die Produktion ist schuld, die Logistik ist schuld, der Vertrieb hat es versemmelt.” Das alles umzukehren und zu sagen: „Nee, wir alle zusammen, wir lösen das gemeinsam, im engen Austausch”, das macht es aus.
Und die neuen Methoden, die neuen Herangehensweisen: Sind die denn krisenfest? Man könnte ja einwenden, dass in Extremsituationen eine straffe Lenkung von oben durch einen kleinen Kreis die einzige Möglichkeit ist.
Sascha Groß: Sie hatten ja nach dem Geheimnis des Erfolgs gefragt. Da bin ich vorhin erstmal zusammengezuckt. Denn die letzten Jahre waren schon extrem wild. Das waren Krisen und Hindernisse, auf die wir – wie andere auch – gestoßen sind, ohne dafür etwas in der Schublade zu haben. Angefangen mit der Corona-Pandemie und den weltweiten Verwerfungen in den Lieferketten. Als Unternehmen hatten wir im Jahr 2021 beispielsweise den Brand in unserer Galvanik in Berlin zu verkraften. Wenn diese neue Basis, die Philipp gerade angesprochen hat, bei uns nicht schon vorhanden gewesen wäre, wenn wir da noch in unseren alten Rollen gewesen wären, …
Das Unternehmen wäre dann nicht schnell und flexibel genug gewesen?
Sascha Groß: Ja. Ich schaue gerade zum früheren Geschäftsleitungsbüro herüber, bei dem wir die Wände buchstäblich eingerissen hatten, und erinnere mich daran, wie es vorher war. Früher hatten wir – ganz klassisch – ein Geschäftsleitungsmitglied für Produktion, Vertrieb und Finanzen. Wir haben in Ressorts gearbeitet und Mitarbeiter in diesen Ressorts haben ihren Führungskräften berichtet. Heute sitzen die Kollegen beieinander und schauen gemeinsam nach übergreifenden Lösungen. So steht aber immer der Kunde, die Lösung, im Vordergrund und wir haben uns gefragt, wie kriegen wir das zusammen hin? Mit den alten Strukturen wären wir ordentlich gestolpert.
Jana Schönfeld: Man kann es auch als Zusammenbringen der alten Disziplinen beschreiben, was wir gemacht haben. Miteinander und nicht übereinander reden, das ist ein entscheidender Aspekt. Neulich habe ich in den USA an einem Meeting teilgenommen. Da waren wir mit 90 Kolleginnen und Kollegen übrigens auch in einem Stuhlkreis. Dort haben Mitarbeiter aus wirklich allen Bereichen gemeinsam überlegt, wie die Vier-Tage-Woche im Warenlager in den Staaten so umgesetzt werden kann, dass es im Ergebnis sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter gut zusammenpasst. Jeder hat sich da eingebracht – und am Ende hatten wir eine Lösung.
Matthias Oetting: Ich bin zwar noch nicht so lange bei Hettich und habe diese Transformation deshalb nur zu einem kleinen Teil mitgemacht. Aber ich bin beruflich mit dem Satz großgeworden: „Verantwortung kann man nicht teilen.” Seit ich bei Hettich bin, habe ich festgestellt: Das geht schon, unter einer bestimmten Bedingung. Wenn sich jeder seiner Fachexpertise bewusst wird, die in seinem Verantwortungsbereich einbringt, mit dem Ziel, gemeinsam die beste Lösung für den Kunden zu finden. Das ist dann die gemeinsame geteilte Verantwortung. Wenn das passiert, purzeln diese ganzen Einzel- und Partikularinteressen einfach weg. Das macht Wege frei. Es werden Energien freigesetzt, die auf einmal in konstruktive Lösungen umgesetzt werden. In so großen Unternehmen wird durch diese Energie sehr viel bewegt.
Bei der Vorbereitung auf unser Interview dachte ich noch, ob man es so beschreiben kann: Es wurden gewisse Managementebenen eingerissen. Aber ganz offenbar ist es das ja nicht, nicht so ein mechanisches Rausschneiden von Stücken, vertikal oder horizontal, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, erklären Sie es mir bitte noch einmal, was anders ist bei Hettich.
Matthias Oetting: Bei mir ist da ein Bild entstanden, bei Ihrer Frage. Ich bin ja seit einer ganzen Weile in der Kommunikation tätig. Mich erinnerte das an die One-to-many-Kommunikation mit einem Sender und vielen Empfängern, wie beim TV. Dann kam die Many-to-many-Kommunikation, wie wir sie von sozialen Netzwerken kennen. Vielleicht klingt es etwas hochtrabend, aber man könnte bei Hettich von einem Many-to-many-Management-Ansatz sprechen, da wir sehr stark in Netzwerken organisiert sind.
Jana Schönfeld: Kommunikation bei Hettich kann man auch als Beispiel dieses Many-to-many-Ansatzes begreifen. Wir möchten möglichst hierarchiefrei kommunizieren. Grundsätzlich ist jeder von uns mit jedem Kollegen in Kontakt. Bei mir sind es beispielsweise etwa 300 Personen aus der Firma, mit denen ich mich regelmäßig persönlich oder digital austausche. Das hört sich vielleicht nach viel an: Wir nutzen externe Social-Media-Kanäle, auf denen wir uns austauschen, haben aber auch ein Hettich-eigenes Social-Media-Tool. Da schreibt das Top-Management selten etwas rein. Wir wollen ja nicht von oben nach unten kommunizieren. Es soll aber jeder Kollege loswerden, was alle wissen sollten. Seit etwa sechs Jahren nutzen wir dieses Tool. Und wir alle werden immer besser. Mindestens einmal am Tag schauen wir da möglichst alle rein. Und für ein internationales Unternehmen mit vielen Standorten ist das sowieso ideal: Morgens habe ich Reaktionen aus Übersee, wenn ich ins Büro komme. Wir sind also nicht immer ganz zur selben Zeit im Dialog, sondern etwas zeitversetzt. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, natürlich auch, wenn es um ernste Dinge geht. Vor anderthalb Jahren, bei der Cyberattacke oder bei dem Brand damals in Berlin: Dann schreiben wir das sofort rein. Kurze knappe Info und erste Hinweise, wie wir uns da alle miteinander jetzt verhalten. Das verteilt sich dann wie ein Lauffeuer durch die Hettich-Welt.
Sascha Groß: Auch das war ein Weg für das obere Management. Ich kann mich noch erinnern an die Fragen, die wir beim Thema Corona hatten. Wie gehen wir damit um? Absolute Transparenz? Können wir den Leuten diese Wahrheit überhaupt zumuten? – Da haben wir damals auch erst mal eine Stunde zusammengesessen, uns ausgetauscht und mit uns gerungen. Dann haben wir entschieden, absolute Transparenz ist der Weg. Wir haben für uns gelernt: Die Transparenz weckt Vertrauen und setzt Kräfte frei. Das war ein Weg, das zu lernen. Mittlerweile sind wir von diesem Weg absolut überzeugt. Bei der Cyber-Attacke im August 2022 auf unsere chinesische Tochter konnten wir sehen, dass wir Kräfte und Kompetenzen haben, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben. Da werfen sich Leute ins Rad, sagen: „Ich habe da eine Idee, ich kenne noch jemanden.” Leute, die man dazu überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Das war eine solche Erfahrung, die wir alle gemeinsam als Firma gemacht haben.
Die größere Offenheit in Ihrer Organisation und Ihrer Kommunikation kann also Innovationen und Wandel fördern, und auch bei Krisen fühlt sich Hettich da besser gerüstet . . .
Michael Lehmkuhl: Das ist wie der Marathon beim Laufen. Den haben wir noch nicht ganz geschafft, aber wir sind da auf einem guten Wege. In unser Tool schreiben Mitarbeiter auch kritische Dinge rein. Mittlerweile ist das selbstverständlich, so war das aber noch vor zehn Jahren nicht möglich. „Leute, ich brauche hierbei Unterstützung”, oder „Wir haben hier ein Prozess-Problem.” Das soll nicht der nice Newsletter des Chefs sein oder mal ein kritisches Schreiben der Geschäftsführung. Sondern wir schauen uns ehrlich in die Augen und sagen: „Können wir so nicht lassen, ändern wir.” Das ist kulturverändernd.
Matthias Oetting: Ein Beispiel aus meinem Bereich: Eine Hettich-Auszubildende, die festgestellt hatte, dass ihre Neigungen und Begabungen doch eher in der Kommunikation liegen. Die hat sich, da sie wusste, dass sie nach der Ausbildung eine Übernahmegarantie von zwei Jahren hatte, um eine passendere Stelle bemüht. So ist sie dann in unserem Team gelandet. Das ermöglichen wir auch. Aber das geht nur, weil keine Silos und Barrieren da sind. In dieser barrierefreien Form war das früher nicht möglich hier – jetzt schon.
Heute fiel ja ein Begriff mehrere Male: der Kunde. Wie sind denn die Feedbacks von Ihren Kunden? Also, falls es die denn gibt, solche Rückmeldungen. Vielleicht spielt für Ihre Kunden die Art, wie Sie sich intern organisieren und wie sie intern kommunizieren, gar keine so große Rolle. Also, ehrlich gefragt: Bemerken Ihre Kunden diese Veränderungen?
Philipp Rode: Wir haben gerade in den letzten Monaten und Jahren Kunden gewonnen, die uns auch neu kennengelernt haben. Da kam oft zurück: „Wow. Toll was ihr ermöglicht.“ Und das sind Feedbacks von kleinen und großen Kunden. Auf der letzten Interzum wurden wir aktiv angesprochen, dass wir beispielsweise während Corona in Sachen Innovation nicht untätig waren. Der ein oder andere Kunde hat da schon Vergleiche zu Wettbewerbern gezogen, die das wohl nicht so hinbekommen haben. Das ist eine tolle Bestätigung.
Mehrwert stiften und Daten teilen
Jana Schönfeld: Wenn ich bei Kunden unterwegs bin, finde ich spannend, dass sie sich für den strategischen Dialog interessieren. Ich bin da zumeist mit unseren Markt-Experten unterwegs, wenn es um die einzelnen Lösungen geht. Aber die Kunden haben auch ein darüber hinausgehendes Interesse. Sie fragen auch: „Wie wollt Ihr Euch als Familienunternehmen weiterentwickeln?”, „Was probiert Ihr in Sachen Unternehmenskultur aus?”, „Wie geht Ihr mit geopolitischen Risiken um?” Oder auch, wie wir mit Cyber-Attacken umgehen. Wir werden dann aber auch gefragt, ob wir in einer bestimmten Weltregion, in der wir tätig sind, vielleicht den Kunden unterstützen können. Solche Anfragen gibt es zunehmend, wenn es um Indien geht, wo wir seit Jahren erfolgreich tätig sind. Das ist ein sehr großer und spannender Markt, der wichtiger wird, aber natürlich auch seine eigenen Gesetze hat. Da können wir gut Brücken bauen und Kontakte herstellen. So stiften wir auch einen Mehrwert unabhängig von unseren Produkten.
Matthias Oetting: Sehr nachgefragt werden auch die strategischen Workshops mit unseren Kunden. Da geht es beispielsweise um die Marktentwicklungen, Trends und Marktanteile. Dinge, die unsere Kunden teilweise nicht wissen. Da wir weltweit vertreten sind, haben wir automatisch mehr Daten. Wir haben intern Kollegen, die für das Thema brennen, die ursprünglich aus dem Bereich der Technischen Fertigung und dem Produktmanagement kommen. Die haben das entwickelt, gemeinsam mit den internationalen Vertriebskolleginnen und -kollegen ein sehr umfangreiches Marktbild gezeichnet, die Daten erhoben, die es sonst nirgendwo gibt. Strategie-Partnerschaft nennen wir das.
In den letzten Monaten sind die Wirtschaftsmedien voll mit Berichten über ausgebrannte Top-Manager, eine sich überfordert fühlende mittlere Führungsebene. Umfragen zeigen, dass sich da locker 60 oder mehr Prozent überfordert fühlen. Auch die Krankenkassen veröffentlichen Berichte über ähnliche Phänomene. Ein Thema auch bei Hettich?
Jana Schönfeld: Ein wichtiger Vorteil bei uns ist: Wir wurden 1888 gegründet, sind in vierter Generation zu 100 Prozent in Familienhand und unsere Gesellschafter haben ein Interesse daran, das Unternehmen langfristig orientiert und über Generationen hinweg gut zu steuern. Wir können uns also immer auf ein kontinuierliches Ziel verlassen. Dieses hat sich für mich in den sieben Jahren, in denen ich hier bin, auch niemals verändert. Niemand drängt uns in Quartalsziele oder schmeißt die Strategie von heute auf morgen um. Das hilft, um Kurs und Richtung zu halten. Außerdem hilft uns, dass wir uns mit den Leidenschaften und Stärken einbringen können, die wir alle haben. Wenn man neben dem klassischen Rollenprofil macht, was einen begeistert, entsteht Begeisterung bei der Arbeit. Vielleicht nicht jeden Tag – aber doch im breiten Durchschnitt. Das gibt mir zumindest jeden Tag mehr Energie, als es mir nimmt, und bewahrt mich vor Überforderung. Und ich hoffe, dass das für viele Kollegen vergleichbar ist.
Sascha Groß: Das Thema Ausgebranntheit kommt weniger von viel Arbeit, sondern hauptsächlich von Frustration oder nicht vorhandener Sinnhaftigkeit. Wir haben hier ein Umfeld, wo man in einem Großteil der Arbeit sinnhafte Arbeit sieht. Wenn ich Spaß an Themen habe, gibt das nochmal Kraft. Natürlich powert man auch mal richtig. Und natürlich braucht man dann auch Ruhephasen und Balance. Jeder von uns muss mit den eigenen Kräften haushalten, wir sind alle Menschen. Nur sprinten, das wäre nicht sinnvoll. Und das würde auch nicht funktionieren.
Michael Lehmkuhl: Das Tolle ist, wenn beispielsweise jemand private Probleme oder Aufgaben in seinem Alltag hat, die auf einmal auftauchen, dann übernimmt jemand anderes den Staffelstab. Eben wie beim Staffellauf.
Matthias Oetting: Man kann im Kleinen auch gut gegensteuern, Erschöpfung vermeiden. Wir müssen auf uns achten, damit wir auch unsere Kraft behalten. Das gilt für Mitarbeiter, für Führungskräfte. Kein Klima der Anspannung erzeugen, E-Mails am Wochenende wirklich nur in Notfällen. Ich habe inzwischen auch das Motto Holidays sind Holy Days. Und es ist so, wie Michael es geschildert hat. Wenn die Eltern eines Mitarbeiters erkranken, dann fangen die anderen das komplett auf. Jeder kann das Vertrauen haben, auf sich selbst achten zu dürfen. Dann kippt das nicht. Jeder von uns hat die Gewissheit: Eine Pause kann man wirklich immer nehmen.
Philipp Rode: Sehr konkret dazu: Antworten, ans Telefon gehen . . . Ich habe manchmal Erlebnisse, da denke ich, hallo, du bist im Meeting oder im Feierabend, dann geh doch nicht ran. Für einige ist das noch so, dass sie diese Reflexe haben.
Oh, am Schmunzeln und Lachen zweier Ihrer Kollegen merke ich, dass sich entweder jemand erwischt fühlt oder dass dieses Verhalten immer mal wieder vorkommt. Belassen wir es dabei, wer da vielleicht noch Handy-Zuckungen verspürt. Wenn ich heute nach Hause fahre und mir überlege, in welches Raster stecke ich Hettich denn jetzt: funktionale Struktur, Matrixorganisation, Teamstruktur, flache Hierarchien . . . Was passt denn da?
Jana Schönfeld: Tandem-Arbeit, Job-Sharing, Delegation von Aufgaben, volle Selbstorganisation: Mit all sowas haben wir auch mal angefangen. Wenn Sie uns vor sieben Jahren interviewt hätten, dann hätten wir Ihnen eher von Konzepten und Tools berichtet, die wir eingeführt haben. Wir hätten über selbstorganisierte Teams gesprochen, über agiles Projektmanagement oder Netzwerkstrukturen. Da haben wir intern sehr genau erklärt, wie das funktioniert und wie man es einführt. Und dann wurden wir schnell von den Kollegen gefragt: „Werden wir jetzt alle dies und das?” Über die Jahre haben wir gemerkt, es kommt nicht so sehr aufs Tool an. Es kommt auf die Grundprinzipien an. Vertrauen, Transparenz und Augenhöhe sind wichtig – und, dass man niemandem etwas aufzwingt. Das ist beispielsweise auch beim Thema Homeoffice so. Manche Mitarbeiter wollen einfach gerne ins Büro, andere eher nicht. Das ist bei 8.600 Menschen jeweils unterschiedlich und bei uns darf das jeder orientiert an der Aufgabe in Abstimmung mit seinem Team selbst entscheiden.
Was macht die Pioniere der Zukunft im Möbelmarkt aus? Wie würden Sie es in einem Satz formulieren?
Jana Schönfeld: Wir schaffen miteinander ein Umfeld, in dem sich jeder mit seinen Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich zum langfristig orientierten Gelingen einbringt. Und wir begegnen uns gegenseitig als Menschen auf Augenhöhe.

Spezial Neue Ideen
Hettich
„Wir haben eine Many-to-many-Management-Kultur“
Durch die Transformation führen mit geänderter Führungskultur: So kann man Aufgabe und deren Lösungsansatz beim Beschlaghersteller Hettich beschreiben. Wie steuert man aus dem eher beschaulichen Kirchlengern einen weltweit tätigen Hersteller, der auch in China, Indien oder den USA seine Erfolge ausbauen will? Wie kommt ein Unternehmen durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre, von Pandemien über weltwirtschaftliche Verwerfungen bis hin zu Konflikten um Rohstoffe? – Wir haben Vertreter des Hettich-Führungsteams in einer morgendlichen Runde vor Ort im Hettich-Forum dazu befragt. Wie sich schnell herausstellte, hätten wir die ganzen Definitionen und Diagramme zu Organisationsstrukturen ruhig zu Hause liegen lassen können. Warum, lesen Sie hier.
22.04.2024
One-to-many-Kommunikation: Outsider im Gespräch mit Philipp Rode, Matthias Oetting, Jana Schönfeld, Sascha Groß, Michael Lehmkuhl
INSIDE: Guten Tag zusammen. Das ist ja eine größere Runde heute Früh. Passenderweise haben wir einen Stuhlkreis gebildet, da kommen wir ja sicher sehr gut ins Gespräch. Wir wollen dem auf die Spur kommen, was man im Allgemeinen als Firmenkultur beschreibt, und dem Erfolgsgeheimnis der Unternehmensgruppe. Was macht das Arbeiten bei Hettich aus, was macht es in Ihren Augen besonders?
Jana Schönfeld: Das wichtigste Grundprinzip ist, dass sich jeder bei uns mit seinen Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich einbringt. Deswegen sitzen wir heute zu fünft hier und nicht als Doppel-Geschäftsführung. Wir fünf sind Vertreter eines großen globalen Managementteams. An einem anderen Tag hätten Sie möglicherweise fünf andere Menschen getroffen. Da wir heute Verantwortung für die Gestaltung der Bilanz-Pressekonferenz übernehmen, die nach unserem Interview stattfinden wird, sind wir nun in dieser Besetzung hier und bringen verschiedene Kompetenzen und Perspektiven ein. Philipp Rode, Markt und Kunde sowie Märkte dieser Welt; Matthias Oetting, der bei uns für Marketing verantwortlich ist; Michael Lehmkuhl, mit dem Schwerpunkt Innovation, Produktmanagement und Produktion, und Sascha Groß, der mit mir das Geschäft global steuert, aber auch eine große Expertise in Produktion, Logistik und Internationalisierung hat; bei mir sind es mehr die Themen Strategie, Kaufmännisches, Unternehmenskultur und HR. Natürlich ist auch jede Persönlichkeit anders. Genau das schätzen wir und diese Unterschiedlichkeit möchten wir in unseren Alltag bei Hettich integrieren und zulassen.
Wie steuert man einen der wichtigsten Beschlaghersteller der Welt? Für Hettich arbeiten ja – verteilt auf 24 Länder – 8.600 Menschen. Welche Struktur ist da wichtig und wie wird diese Struktur aktuell mit Leben gefüllt?
Jana Schönfeld: Jeder Kollege, jede Kollegin bei uns hat unterschiedliche Leidenschaften: um Kunden zu begeistern, für tolle technische Lösungen, für Arbeits- und Gesundheitsschutz, für Nachhaltigkeit, für digitale Tools oder Kommunikation auf neuen Wegen, jemand anderes mehr für persönliche Begegnungen. Das steht nicht immer auf der Visitenkarte, doch wir bieten unseren Kollegen Möglichkeiten an, diese Interessen einzubringen. Unsere Idee dahinter: So muss sich niemand verstellen, arbeiten macht mehr Spaß und wir können alle gemeinsam erfolgreicher sein. Das ist ein wichtiger Baustein für uns.
Das klingt ja fast wie eine Fußballmannschaft, vielleicht eine ganz ohne Trainer-Team. Organisiert sich die Mannschaft selber?
Jana Schönfeld (lacht): Da muss ich doch gleich an einen meiner Kollegen übergeben, die mehr Fußball-Expertise haben . . .
Michael Lehmkuhl: Mannschaft ist ein gutes Beispiel. Mannschaft ohne Trainer, das ist eine Diskussion, die wir intern sehr intensiv führen. Wir haben verschiedenste Formen, wie wir unsere Teams führen, also nicht die eine Management-Methode oder Organisationsform. Bleiben wir im Bild: Wir haben Mannschaften, die organisieren sich selbst. Die haben ihren Spieler-Trainer in der Gruppe. Das sind Beispiele, da haben die Mitarbeiter teilweise zu uns gesagt: „Wir brauchen keine Führungskraft.” Also haben wir das zugelassen.
Was sind denn das für Gruppen bei Hettich, die so frei arbeiten? Können Sie da mal ein oder zwei Beispiele nennen?
Michael Lehmkuhl: Vor ein paar Jahren, so etwa 2016 oder 2017, haben wir erstmals mit selbstorganisierten Teams experimentiert. In dem Fall war das der Bereich Steuern. Es stand ein Führungswechsel an und das war der Anlass, es zu probieren. Wir haben geschaut, was macht denn an dieser Position die Führungskraft bisher aus? Menschen entwickeln, ihnen Möglichkeiten eröffnen. Wie konnten wir das weiter gewährleisten ohne die Führungskraft? Wir geben den Kollegen als Experten Freiraum sich einzubringen, sie geben sich gegenseitig fachliches Sparring. Wo erforderlich, assistieren wir als Coaches. Ein anderes Beispiel: Das Experten-Team, das die Managementprozesse rund um Corporate Responsibility aufstellt, haben wir später ebenfalls als selbstorganisiertes Team aufgestellt, nach dem Modell Spieler-Trainer, wenn man im Bild bleiben will.
Aber nicht alle arbeiten bei Hettich so, oder?
Michael Lehmkuhl: Wir haben auch Lösungen gefunden, da haben wir ein Trainer-Team, in einem Beispiel ein Trainer-Trio. R&D, Produkt- und Innovationsmanagement: Das waren früher getrennte Abteilungen bei uns, jetzt sind sie eine große Mannschaft. Damit nicht unterm Strich gegeneinander gearbeitet wird, sondern gemeinsam für den Kunden, haben wir nun ein Team von 150 Mitarbeitern mit drei Trainern. Alle Teile der Mannschaft spielen gemeinsam, vom Torwart bis zum Stürmer. Da ist immer einer ansprechbar, alle sind verantwortlich für den ganzen Prozess. Und das funktioniert ebenfalls sehr gut.
-857dc8b9.jpeg)
Sascha Groß: Jahrgang 1974, bei Hettich seit 2004. Aktuelle Aufgabe: seit 2017 Geschäftsführer der Hettich-Gruppe. Werdegang im Unternehmen: Projektmanager, Geschäftsführer Hettich China, Geschäftsführer Hettich Tschechien, Regional Director
-05a30abc.jpeg)
Matthias Oetting: Jahrgang 1977, bei Hettich seit 2023. Aktuelle Aufgabe: seit 2023 Director Marketing bei Hettich in Kirchlengern. Werdegang im Unternehmen: als Director Marketing eingestiegen
-8603bdb1.jpeg)
Jana Schönfeld: Jahrgang 1978, bei Hettich seit 2017. Aktuelle Aufgabe: Geschäftsführerin der Hettich-Gruppe. Werdegang im Unternehmen: als Geschäftsführerin eingestiegen
-1968734c.jpeg)
Philipp Rode: Jahrgang 1979, bei Hettich seit 2016. Aktuelle Aufgabe: Seit 2018 Geschäftsführer in der Hettich-Gruppe am Standort Kirchlengern. Schwerpunkt: Vertrieb. Werdegang im Unternehmen: 2018 Geschäftsführer Vertrieb International Export, seit 2021 Geschäftsführer Vertrieb
-ca8f5d07.jpeg)
Michael Lehmkuhl: Jahrgang 1976, bei Hettich seit 2002. Aktuelle Aufgabe: seit 2016 Geschäftsführer in der Hettich-Gruppe am Standort Kirchlengern. Schwerpunkte u.a. im Innovationsmanagement, Produktmanagement, F&E, Projekte und Qualitätsmanagement. Seit 2024 weitere Tätigkeitsschwerpunkte im Marketing und Vertrieb in der Gruppe.
Diese drei Abteilungen haben Sie dann also ganz aufgelöst?
Michael Lehmkuhl: Von Abteilungen sprechen wir schon lange nicht mehr. Wir haben Funktionen. Und wir haben Menschen, die spezielle Expertisen für bestimmte Funktionen haben. Natürlich werden sie immer noch irgendwo organisatorisch zugeordnet. Wir leben es nicht als Bereich, sondern als Gesamtheit. Plakativ gesprochen: gemeinsames Arbeiten auf einer gemeinsamen Fläche und keine Feier nur der Entwickler, des Vertriebs oder der IT. Das zieht sich so durchs ganze Unternehmen. Und da ist das Zusammenarbeiten einfach schon durch solche Maßnahmen deutlich besser für alle Beteiligten.
Philipp Rode: Wir haben in der Vergangenheit auch Firmen zugekauft. Wenn man von der Gesamtmannschaft redet und von Abwehr, Mittelfeld und Sturm: Das waren teilweise unterschiedliche Einheiten, also Gesellschaften. Wir hatten ein durchaus ausgeprägtes internes Gesellschaftsdenken. Wir hatten einen Forschungs- und Entwicklungs-Bereich hier, einen da, den nächsten dort. Das ist das, was Michael gerade meinte: Da war wenig Interaktion oder nicht genügend. Und das haben wir in den letzten fünf Jahren gut hingekriegt. Weg von Mannschaftsteilen, hin zu einer Gesamtmannschaft. Ich kann mich noch gut an ein Meeting erinnern, da saßen Außendienst und Vertrieb erstmals mit den Entwicklern zusammen und haben über die Validierung eines neuen Produkts geredet. Dabei sind – auf beiden Seiten – Augen aufgegangen. Da kam es ständig zu „Ach so, deshalb”-Momenten. Das ist ein riesiger Vorteil, dass wir als ein Team denken und nicht in Abteilungen oder sogar in Einzelgesellschaften. Es ist nicht mehr so, wie es – überspitzt gesagt – zuvor war: „Die Produktion ist schuld, die Logistik ist schuld, der Vertrieb hat es versemmelt.” Das alles umzukehren und zu sagen: „Nee, wir alle zusammen, wir lösen das gemeinsam, im engen Austausch”, das macht es aus.
Und die neuen Methoden, die neuen Herangehensweisen: Sind die denn krisenfest? Man könnte ja einwenden, dass in Extremsituationen eine straffe Lenkung von oben durch einen kleinen Kreis die einzige Möglichkeit ist.
Sascha Groß: Sie hatten ja nach dem Geheimnis des Erfolgs gefragt. Da bin ich vorhin erstmal zusammengezuckt. Denn die letzten Jahre waren schon extrem wild. Das waren Krisen und Hindernisse, auf die wir – wie andere auch – gestoßen sind, ohne dafür etwas in der Schublade zu haben. Angefangen mit der Corona-Pandemie und den weltweiten Verwerfungen in den Lieferketten. Als Unternehmen hatten wir im Jahr 2021 beispielsweise den Brand in unserer Galvanik in Berlin zu verkraften. Wenn diese neue Basis, die Philipp gerade angesprochen hat, bei uns nicht schon vorhanden gewesen wäre, wenn wir da noch in unseren alten Rollen gewesen wären, …
Das Unternehmen wäre dann nicht schnell und flexibel genug gewesen?
Sascha Groß: Ja. Ich schaue gerade zum früheren Geschäftsleitungsbüro herüber, bei dem wir die Wände buchstäblich eingerissen hatten, und erinnere mich daran, wie es vorher war. Früher hatten wir – ganz klassisch – ein Geschäftsleitungsmitglied für Produktion, Vertrieb und Finanzen. Wir haben in Ressorts gearbeitet und Mitarbeiter in diesen Ressorts haben ihren Führungskräften berichtet. Heute sitzen die Kollegen beieinander und schauen gemeinsam nach übergreifenden Lösungen. So steht aber immer der Kunde, die Lösung, im Vordergrund und wir haben uns gefragt, wie kriegen wir das zusammen hin? Mit den alten Strukturen wären wir ordentlich gestolpert.
Jana Schönfeld: Man kann es auch als Zusammenbringen der alten Disziplinen beschreiben, was wir gemacht haben. Miteinander und nicht übereinander reden, das ist ein entscheidender Aspekt. Neulich habe ich in den USA an einem Meeting teilgenommen. Da waren wir mit 90 Kolleginnen und Kollegen übrigens auch in einem Stuhlkreis. Dort haben Mitarbeiter aus wirklich allen Bereichen gemeinsam überlegt, wie die Vier-Tage-Woche im Warenlager in den Staaten so umgesetzt werden kann, dass es im Ergebnis sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter gut zusammenpasst. Jeder hat sich da eingebracht – und am Ende hatten wir eine Lösung.
Matthias Oetting: Ich bin zwar noch nicht so lange bei Hettich und habe diese Transformation deshalb nur zu einem kleinen Teil mitgemacht. Aber ich bin beruflich mit dem Satz großgeworden: „Verantwortung kann man nicht teilen.” Seit ich bei Hettich bin, habe ich festgestellt: Das geht schon, unter einer bestimmten Bedingung. Wenn sich jeder seiner Fachexpertise bewusst wird, die in seinem Verantwortungsbereich einbringt, mit dem Ziel, gemeinsam die beste Lösung für den Kunden zu finden. Das ist dann die gemeinsame geteilte Verantwortung. Wenn das passiert, purzeln diese ganzen Einzel- und Partikularinteressen einfach weg. Das macht Wege frei. Es werden Energien freigesetzt, die auf einmal in konstruktive Lösungen umgesetzt werden. In so großen Unternehmen wird durch diese Energie sehr viel bewegt.
Bei der Vorbereitung auf unser Interview dachte ich noch, ob man es so beschreiben kann: Es wurden gewisse Managementebenen eingerissen. Aber ganz offenbar ist es das ja nicht, nicht so ein mechanisches Rausschneiden von Stücken, vertikal oder horizontal, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, erklären Sie es mir bitte noch einmal, was anders ist bei Hettich.
Matthias Oetting: Bei mir ist da ein Bild entstanden, bei Ihrer Frage. Ich bin ja seit einer ganzen Weile in der Kommunikation tätig. Mich erinnerte das an die One-to-many-Kommunikation mit einem Sender und vielen Empfängern, wie beim TV. Dann kam die Many-to-many-Kommunikation, wie wir sie von sozialen Netzwerken kennen. Vielleicht klingt es etwas hochtrabend, aber man könnte bei Hettich von einem Many-to-many-Management-Ansatz sprechen, da wir sehr stark in Netzwerken organisiert sind.
Jana Schönfeld: Kommunikation bei Hettich kann man auch als Beispiel dieses Many-to-many-Ansatzes begreifen. Wir möchten möglichst hierarchiefrei kommunizieren. Grundsätzlich ist jeder von uns mit jedem Kollegen in Kontakt. Bei mir sind es beispielsweise etwa 300 Personen aus der Firma, mit denen ich mich regelmäßig persönlich oder digital austausche. Das hört sich vielleicht nach viel an: Wir nutzen externe Social-Media-Kanäle, auf denen wir uns austauschen, haben aber auch ein Hettich-eigenes Social-Media-Tool. Da schreibt das Top-Management selten etwas rein. Wir wollen ja nicht von oben nach unten kommunizieren. Es soll aber jeder Kollege loswerden, was alle wissen sollten. Seit etwa sechs Jahren nutzen wir dieses Tool. Und wir alle werden immer besser. Mindestens einmal am Tag schauen wir da möglichst alle rein. Und für ein internationales Unternehmen mit vielen Standorten ist das sowieso ideal: Morgens habe ich Reaktionen aus Übersee, wenn ich ins Büro komme. Wir sind also nicht immer ganz zur selben Zeit im Dialog, sondern etwas zeitversetzt. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, natürlich auch, wenn es um ernste Dinge geht. Vor anderthalb Jahren, bei der Cyberattacke oder bei dem Brand damals in Berlin: Dann schreiben wir das sofort rein. Kurze knappe Info und erste Hinweise, wie wir uns da alle miteinander jetzt verhalten. Das verteilt sich dann wie ein Lauffeuer durch die Hettich-Welt.
Sascha Groß: Auch das war ein Weg für das obere Management. Ich kann mich noch erinnern an die Fragen, die wir beim Thema Corona hatten. Wie gehen wir damit um? Absolute Transparenz? Können wir den Leuten diese Wahrheit überhaupt zumuten? – Da haben wir damals auch erst mal eine Stunde zusammengesessen, uns ausgetauscht und mit uns gerungen. Dann haben wir entschieden, absolute Transparenz ist der Weg. Wir haben für uns gelernt: Die Transparenz weckt Vertrauen und setzt Kräfte frei. Das war ein Weg, das zu lernen. Mittlerweile sind wir von diesem Weg absolut überzeugt. Bei der Cyber-Attacke im August 2022 auf unsere chinesische Tochter konnten wir sehen, dass wir Kräfte und Kompetenzen haben, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben. Da werfen sich Leute ins Rad, sagen: „Ich habe da eine Idee, ich kenne noch jemanden.” Leute, die man dazu überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Das war eine solche Erfahrung, die wir alle gemeinsam als Firma gemacht haben.
Die größere Offenheit in Ihrer Organisation und Ihrer Kommunikation kann also Innovationen und Wandel fördern, und auch bei Krisen fühlt sich Hettich da besser gerüstet . . .
Michael Lehmkuhl: Das ist wie der Marathon beim Laufen. Den haben wir noch nicht ganz geschafft, aber wir sind da auf einem guten Wege. In unser Tool schreiben Mitarbeiter auch kritische Dinge rein. Mittlerweile ist das selbstverständlich, so war das aber noch vor zehn Jahren nicht möglich. „Leute, ich brauche hierbei Unterstützung”, oder „Wir haben hier ein Prozess-Problem.” Das soll nicht der nice Newsletter des Chefs sein oder mal ein kritisches Schreiben der Geschäftsführung. Sondern wir schauen uns ehrlich in die Augen und sagen: „Können wir so nicht lassen, ändern wir.” Das ist kulturverändernd.
Matthias Oetting: Ein Beispiel aus meinem Bereich: Eine Hettich-Auszubildende, die festgestellt hatte, dass ihre Neigungen und Begabungen doch eher in der Kommunikation liegen. Die hat sich, da sie wusste, dass sie nach der Ausbildung eine Übernahmegarantie von zwei Jahren hatte, um eine passendere Stelle bemüht. So ist sie dann in unserem Team gelandet. Das ermöglichen wir auch. Aber das geht nur, weil keine Silos und Barrieren da sind. In dieser barrierefreien Form war das früher nicht möglich hier – jetzt schon.
Heute fiel ja ein Begriff mehrere Male: der Kunde. Wie sind denn die Feedbacks von Ihren Kunden? Also, falls es die denn gibt, solche Rückmeldungen. Vielleicht spielt für Ihre Kunden die Art, wie Sie sich intern organisieren und wie sie intern kommunizieren, gar keine so große Rolle. Also, ehrlich gefragt: Bemerken Ihre Kunden diese Veränderungen?
Philipp Rode: Wir haben gerade in den letzten Monaten und Jahren Kunden gewonnen, die uns auch neu kennengelernt haben. Da kam oft zurück: „Wow. Toll was ihr ermöglicht.“ Und das sind Feedbacks von kleinen und großen Kunden. Auf der letzten Interzum wurden wir aktiv angesprochen, dass wir beispielsweise während Corona in Sachen Innovation nicht untätig waren. Der ein oder andere Kunde hat da schon Vergleiche zu Wettbewerbern gezogen, die das wohl nicht so hinbekommen haben. Das ist eine tolle Bestätigung.
Mehrwert stiften und Daten teilen
Jana Schönfeld: Wenn ich bei Kunden unterwegs bin, finde ich spannend, dass sie sich für den strategischen Dialog interessieren. Ich bin da zumeist mit unseren Markt-Experten unterwegs, wenn es um die einzelnen Lösungen geht. Aber die Kunden haben auch ein darüber hinausgehendes Interesse. Sie fragen auch: „Wie wollt Ihr Euch als Familienunternehmen weiterentwickeln?”, „Was probiert Ihr in Sachen Unternehmenskultur aus?”, „Wie geht Ihr mit geopolitischen Risiken um?” Oder auch, wie wir mit Cyber-Attacken umgehen. Wir werden dann aber auch gefragt, ob wir in einer bestimmten Weltregion, in der wir tätig sind, vielleicht den Kunden unterstützen können. Solche Anfragen gibt es zunehmend, wenn es um Indien geht, wo wir seit Jahren erfolgreich tätig sind. Das ist ein sehr großer und spannender Markt, der wichtiger wird, aber natürlich auch seine eigenen Gesetze hat. Da können wir gut Brücken bauen und Kontakte herstellen. So stiften wir auch einen Mehrwert unabhängig von unseren Produkten.
Matthias Oetting: Sehr nachgefragt werden auch die strategischen Workshops mit unseren Kunden. Da geht es beispielsweise um die Marktentwicklungen, Trends und Marktanteile. Dinge, die unsere Kunden teilweise nicht wissen. Da wir weltweit vertreten sind, haben wir automatisch mehr Daten. Wir haben intern Kollegen, die für das Thema brennen, die ursprünglich aus dem Bereich der Technischen Fertigung und dem Produktmanagement kommen. Die haben das entwickelt, gemeinsam mit den internationalen Vertriebskolleginnen und -kollegen ein sehr umfangreiches Marktbild gezeichnet, die Daten erhoben, die es sonst nirgendwo gibt. Strategie-Partnerschaft nennen wir das.
In den letzten Monaten sind die Wirtschaftsmedien voll mit Berichten über ausgebrannte Top-Manager, eine sich überfordert fühlende mittlere Führungsebene. Umfragen zeigen, dass sich da locker 60 oder mehr Prozent überfordert fühlen. Auch die Krankenkassen veröffentlichen Berichte über ähnliche Phänomene. Ein Thema auch bei Hettich?
Jana Schönfeld: Ein wichtiger Vorteil bei uns ist: Wir wurden 1888 gegründet, sind in vierter Generation zu 100 Prozent in Familienhand und unsere Gesellschafter haben ein Interesse daran, das Unternehmen langfristig orientiert und über Generationen hinweg gut zu steuern. Wir können uns also immer auf ein kontinuierliches Ziel verlassen. Dieses hat sich für mich in den sieben Jahren, in denen ich hier bin, auch niemals verändert. Niemand drängt uns in Quartalsziele oder schmeißt die Strategie von heute auf morgen um. Das hilft, um Kurs und Richtung zu halten. Außerdem hilft uns, dass wir uns mit den Leidenschaften und Stärken einbringen können, die wir alle haben. Wenn man neben dem klassischen Rollenprofil macht, was einen begeistert, entsteht Begeisterung bei der Arbeit. Vielleicht nicht jeden Tag – aber doch im breiten Durchschnitt. Das gibt mir zumindest jeden Tag mehr Energie, als es mir nimmt, und bewahrt mich vor Überforderung. Und ich hoffe, dass das für viele Kollegen vergleichbar ist.
Sascha Groß: Das Thema Ausgebranntheit kommt weniger von viel Arbeit, sondern hauptsächlich von Frustration oder nicht vorhandener Sinnhaftigkeit. Wir haben hier ein Umfeld, wo man in einem Großteil der Arbeit sinnhafte Arbeit sieht. Wenn ich Spaß an Themen habe, gibt das nochmal Kraft. Natürlich powert man auch mal richtig. Und natürlich braucht man dann auch Ruhephasen und Balance. Jeder von uns muss mit den eigenen Kräften haushalten, wir sind alle Menschen. Nur sprinten, das wäre nicht sinnvoll. Und das würde auch nicht funktionieren.
Michael Lehmkuhl: Das Tolle ist, wenn beispielsweise jemand private Probleme oder Aufgaben in seinem Alltag hat, die auf einmal auftauchen, dann übernimmt jemand anderes den Staffelstab. Eben wie beim Staffellauf.
Matthias Oetting: Man kann im Kleinen auch gut gegensteuern, Erschöpfung vermeiden. Wir müssen auf uns achten, damit wir auch unsere Kraft behalten. Das gilt für Mitarbeiter, für Führungskräfte. Kein Klima der Anspannung erzeugen, E-Mails am Wochenende wirklich nur in Notfällen. Ich habe inzwischen auch das Motto Holidays sind Holy Days. Und es ist so, wie Michael es geschildert hat. Wenn die Eltern eines Mitarbeiters erkranken, dann fangen die anderen das komplett auf. Jeder kann das Vertrauen haben, auf sich selbst achten zu dürfen. Dann kippt das nicht. Jeder von uns hat die Gewissheit: Eine Pause kann man wirklich immer nehmen.
Philipp Rode: Sehr konkret dazu: Antworten, ans Telefon gehen . . . Ich habe manchmal Erlebnisse, da denke ich, hallo, du bist im Meeting oder im Feierabend, dann geh doch nicht ran. Für einige ist das noch so, dass sie diese Reflexe haben.
Oh, am Schmunzeln und Lachen zweier Ihrer Kollegen merke ich, dass sich entweder jemand erwischt fühlt oder dass dieses Verhalten immer mal wieder vorkommt. Belassen wir es dabei, wer da vielleicht noch Handy-Zuckungen verspürt. Wenn ich heute nach Hause fahre und mir überlege, in welches Raster stecke ich Hettich denn jetzt: funktionale Struktur, Matrixorganisation, Teamstruktur, flache Hierarchien . . . Was passt denn da?
Jana Schönfeld: Tandem-Arbeit, Job-Sharing, Delegation von Aufgaben, volle Selbstorganisation: Mit all sowas haben wir auch mal angefangen. Wenn Sie uns vor sieben Jahren interviewt hätten, dann hätten wir Ihnen eher von Konzepten und Tools berichtet, die wir eingeführt haben. Wir hätten über selbstorganisierte Teams gesprochen, über agiles Projektmanagement oder Netzwerkstrukturen. Da haben wir intern sehr genau erklärt, wie das funktioniert und wie man es einführt. Und dann wurden wir schnell von den Kollegen gefragt: „Werden wir jetzt alle dies und das?” Über die Jahre haben wir gemerkt, es kommt nicht so sehr aufs Tool an. Es kommt auf die Grundprinzipien an. Vertrauen, Transparenz und Augenhöhe sind wichtig – und, dass man niemandem etwas aufzwingt. Das ist beispielsweise auch beim Thema Homeoffice so. Manche Mitarbeiter wollen einfach gerne ins Büro, andere eher nicht. Das ist bei 8.600 Menschen jeweils unterschiedlich und bei uns darf das jeder orientiert an der Aufgabe in Abstimmung mit seinem Team selbst entscheiden.
Was macht die Pioniere der Zukunft im Möbelmarkt aus? Wie würden Sie es in einem Satz formulieren?
Jana Schönfeld: Wir schaffen miteinander ein Umfeld, in dem sich jeder mit seinen Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich zum langfristig orientierten Gelingen einbringt. Und wir begegnen uns gegenseitig als Menschen auf Augenhöhe.
-13608005.jpeg)